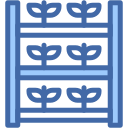This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Urban Vertical Farming: Eine Lösung für Herausforderungen der Ernährungssicherheit
Urban Vertical Farming steht im Mittelpunkt innovativer Lösungsansätze, um den wachsenden Herausforderungen der Ernährungssicherheit in Städten zu begegnen. Die rasante Urbanisierung, der Klimawandel und limitierte Anbauflächen stellen Städte weltweit vor die Frage, wie frische, gesunde und nachhaltige Lebensmittel bereitgestellt werden können. Vertical Farming nutzt modernste Technologien, um Pflanzen platzsparend und ressourceneffizient direkt in urbanen Räumen zu kultivieren. Gerade in Deutschland gewinnt dieses Konzept zunehmend an Relevanz. Auf dieser Seite erfahren Sie, welches Potenzial in urbaner vertikaler Landwirtschaft steckt, welche Technologien sie möglich machen, wie sie ökologische und soziale Herausforderungen adressiert und welche zukünftigen Entwicklungen diesen innovativen Bereich prägen könnten.
Definition und Funktionsweise von Urbaner Vertikaler Landwirtschaft